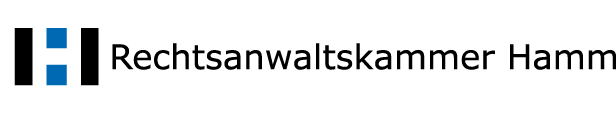von Rechtsanwalt Dr. Dieter Finzel, Hamm
Ehrenpräsident der Rechtsanwaltskammer Hamm
Zu diesem Thema möchte ich mich auf vier, zurzeit in der Satzungsversammlung, in der BRAK-Hauptversammlung und im BRAO-Ausschuss diskutierte Probleme beschränken, nämlich:
1. Die Anwendung des § 73 Abs. 3 BRAO
2. Fremdgeld und Abrechnungsverhalten des Rechtsanwalts nach § 23 BRAO
3. Syndikusanwalt und
4. Sanktionierte Pflichtfortbildung.
Bevor ich hierzu im Einzelnen Stellung nehme, möchte ich Ihnen eine interessante Überlegung der Kammer München nicht vorenthalten. Herr Präsident Staehle teilte mir kürzlich mit, der dortige Vorstand habe die Frage diskutiert, ob das anwaltsgerichtliche Vertretungsverbot nach § 114 Abs. 1 Nr. 4 BRAO, also das Verbot, „auf bestimmten Rechtsgebieten als Vertreter und Beistand für die Dauer von einem Jahr bis zu fünf Jahren tätig zu werden“, zur Bewährung ausgesetzt werden könnte.
Ich bin kein Strafrechtler. Wenn man aber bedenkt, dass unter den Voraussetzungen des § 56 StGB Strafen auf Bewährung ausgesetzt werden können, wäre es jedenfalls eine Überlegung wert, dieses Institut auch bei der Sanktionierung eines Rechtsanwalts anzuwenden. Ich habe es noch nicht zu Ende gedacht. Es sollte für Sie lediglich ein Denkanstoß sein.
Und nun zu den Einzelthemen.
Anwendung des § 73 Abs. 3 BRAO
Diese Vorschrift ist ein Ärgernis. Worum geht es? Im Beschwerdeverfahren bei der Kammer erfuhren die Beschwerdeführer in der Vergangenheit so gut wie nie, ob ihre Beschwerde begründet war oder nicht. Es entsprach den Gepflogenheiten der Kammern, den Beschwerdeführern nach Abschluss des Verfahrens mitzuteilen: „Die Kammer hat das berufsrechtlich Notwendige veranlasst“. Dies war ebenso knapp wie nichtssagend. Deshalb verwundert es nicht, dass sich die Beschwerden beim BMJ mehrten, die darauf drängten, den Beschwerdefüher über den Gang und insbesondere das Ergebnis des Verfahrens zu unterrichten.
Der Gesetzgeber griff dies im Modernisierungsgesetz vom 30.07.09 auf und es kam zu einer Neufassung des § 73 Abs. 3 BRAO wie folgt:
„Im Beschwerdeverfahren setzt der Vorstand den Beschwerdeführer von seiner Entscheidung in Kenntnis. Die Mitteilung erfolgt nach Abschluss des Verfahrens einschließlich des Einspruchsverfahrens und ist mit einer kurzen Darstellung der wesentlichen Gründe für die Entscheidung zu versehen. § 76 bleibt unberührt. Die Mitteilung ist nicht anfechtbar.“
Schon bald zeigte sich, dass der Gesetzgeber hier auf halbem Wege stehen geblieben war. Dem Vorstand wird nämlich lediglich aufgegeben, dem Beschwerdeführer von seiner Entscheidung Kenntnis zu geben. Offen bleibt, wie zu verfahren ist, wenn gegen einen Bescheid der Kammer ein Rechtsmittel eingelegt oder die Sache an die Generalstaatsanwaltschaft abgegeben wird. Einzelne Kammern beriefen sich auf ihre Verschwiegenheitspflicht, andere meinten, die Kammern seien am weiteren Verfahrensgang ohnehin nicht beteiligt und dürften deshalb hierüber auch nichts mitteilen, und wieder andere meinten, dass Transparenzgebot fordere weitergehende Mitteilungen. Der neue § 73 Abs. 3 BRAO brachte also keine Besserung des bisherigen Zustandes, allenfalls einen Flickenteppich innerhalb der bundesdeutschen Kammern in der Handhabung der Vorschrift.
Auf Rückfrage der Kammer Düsseldorf teilte der zuständige Sachbearbeiter beim BMJ @SB@brieflich mit, entsprechend dem Transparenzgebot sei der Beschwerdeführer auch über die weiteren Verfahrensschritte zu unterrichten. Dies war natürlich nicht befriedigend. Ein Schreiben des BMJ kann die Kammer wohl nicht von ihrer Verschwiegenheitspflicht entbinden.
Der daraufhin vom Präsidium der BRAK beauftragte BRAO-Ausschuss legte in der BRAK-Hauptversammlung vom 18.10.2012 in Augsburg folgende Neufassung des § 73 Abs. 3 BRAO vor:
„In Beschwerdeverfahren setzt der Vorstand den Beschwerdeführer von seiner Entscheidung in Kenntnis. Die Mitteilung erfolgt nach Abschluss des Verfahrens einschließlich eines Einspruchverfahrens. Im Falle eines Antrages des Beschwerdegegners auf anwaltsgerichtliche Entscheidung, bei Erhebung einer Klage zum Anwaltsgerichtshof oder bei Abgabe der Sache an die Staatsanwaltschaft (§ 120 BRAO) unterrichtet der Vorstand den Beschwerdeführer hierüber sowie über den Abschluss der jeweiligen Verfahren. Sämtliche Mitteilungen sind mit einer kurzen Darstellung der wesentlichen Gründe für die jeweilige Entscheidung zu versehen. Sie sind nicht anfechtbar. § 76 BRAO bleibt im Übrigen unberührt.“
Man kann unschwer erkennen, dass in diesem Vorschlag alle Verfahrensschritte eines Aufsichtsverfahrens erfasst sind und die Kammer dem Beschwerdeführer das endgültige Ergebnis des Verfahrens mitzuteilen hat.
Überraschenderweise meldeten sich in der BRAK-Hauptversammlung in Augsburg zwei Kammern mit dem Einwand, die Abgabe an die Generalstaatsanwaltschaft dürfe dem Beschwerdeführer nicht mitgeteilt werden. Der betroffene Kollege werde damit vorverurteilt. Prompt wurde der Vorschlag des BRAO-Ausschusses mit knapper Mehrheit abgelehnt und es verbleibt jedenfalls zunächst beim bisherigen § 73 Abs. 3 BRAO. Wenn die Kammern also, wie es wohl zwischenzeitlich allenthalben geschieht, den Beschwerdeführer auch über den Gang des Verfahrens über das Einspruchsverfahren hinaus unterrichten, dann geschieht dies – zurückhaltend formuliert – praeter legem.
Ich halte dies jedenfalls zur Zeit noch für vertretbar. Die Vorschrift des § 73 Abs. 3 BRAO wurde aus Transparenzgründen eingeführt. Sie ist erkennbar missglückt, nämlich – jedenfalls dem Wortlaut nach – auf halbem Wege stehen geblieben. Die Bundesrechtsanwaltskammer hat sich bislang nicht aufgerafft, den Vorschlag des BRAO-Ausschusses wieder auf die Tagesordnung zu setzen. Es ist deshalb Sache der Kammern, dem richtig
verstandenen Transparenzgebot gerecht zu werden und das heißt: Im Rahmen eines Aufsichtsverfahrens bei der Kammer und eines möglicherweise weitergehenden Verfahrens ist bei der jeweiligen Mitteilung stets abzuwägen zwischen dem legitimen Informationsinteresse des Beschwerdeführers einerseits und dem ebenso legitimen Integritätsinteresse des betroffenen Kollegen andererseits. Letzterer darf nicht Gefahr laufen, dass der Beschwerdeführer mit einem Zwischenbescheid der Kammer „hausieren“ geht und es so zu einer Vorverurteilung des betroffenen Kollegen kommt. Anders ausgedrückt: Gegenüber dem Beschwerdeführer darf nicht „gemauert“ werden und der betroffene Kollege darf nicht vorverurteilt werden.
Die Herausnahme eines einzelnen Verfahrensschrittes aus der Mitteilungs-pflicht der Kammer, hier die Abgabe an die Generalstaatsanwaltschaft, ist nach meinem Verständnis ein Systembruch. Man kann diesen Verfahrensschritt nicht kurzerhand unterschlagen und den Beschwerdeführer insoweit im Dunkeln stehen lassen. Es bleibt also dem Geschick einer jeden Kammer überlassen, hier eine Formulierung zu finden, die diesen Spagat schafft. Die Kammer Düsseldorf hat hierzu einen guten Formulierungsvorschlag vorgelegt und nach meiner Kenntnis verfährt unsere Kammer entsprechend.
Trotzdem mein Appell an die hier vertretenen Kammern: Sie sollten gemeinschaftlich beim Präsidium der BRAK vorstellig werden und beantragen, den vom BRAO-Ausschuss vorgelegten Vorschlag zu § 73 Abs. 3 BRAO erneut auf die Tagesordnung der BRAK-HV zu setzen. Ich bin so zuversichtlich, dass es gelingen wird, die Mehrheit der Kammern davon zu überzeugen, dass der geltende § 73 Abs. 3 BRAO reformbedürftig ist. Die derzeitige praeter-legem-Handhabung kann jedenfalls kein Dauerzustand sein. Die Kammern laufen sonst Gefahr, dass ihnen irgendwann ein Beschwerdeführer einen Verstoß gegen die Verschwiegenheitspflicht nach § 76 BRAO vorwirft. Und dies sollten die Kammern vermeiden.
Fremdgeld und Abrechnungsverhalten § 23 BORA
Das hierzu beim AGH NRW anhängige Anschuldigungserzwingungsverfahren[1] dürfte den meisten von Ihnen präsent sein. Im Kern ging es um folgendes:
Der betroffene Rechtsanwalt erteilte seiner Mandantin am 04.02.2011 für seine beratende Tätigkeit Abrechnung und stellte fest, dass sich letztlich zugunsten der Mandantin ein Überschuss in Höhe von rund 23.200,-- € ergab. Er bat die Mandantin um Mitteilung, wohin der Erstattungsbetrag überwiesen werden sollte. Die entsprechende Mitteilung erfolgte unverzüglich, aber der Kollege zahlte nicht. Erst in der zweiten Junihälfte zahlte er drei Teilbeträge und versprach die Rückzahlung des dann immer noch offenen Restbetrages von 10.000,-- € zum 01.07.2011. Da keine Zahlung erfolgte, erhob die Mandantin am 04.07.2011 Beschwerde bei der zuständigen RAK Hamm und leitete ein Mahnverfahren ein.
Die Staatsanwaltschaft lehnte die von der Kammer beantragte Einleitung eines anwaltsgerichtlichen Verfahrens ab, mit der Begründung, die eigentliche Abrechnung nach § 23 BORA sei rechtzeitig erfolgt und bei dem überschüssigen Honorarvorschuss handele es sich entgegen der Ansicht der Kammer nicht um Fremdgeld. Die nicht rechtzeitige Auskehrung des Überschusses sei also kein Berufsrechtsverstoß.
Den daraufhin von der Kammer gestellten Anschuldigungserzwingungsantrag wies der AGH als unbegründet zurück im Kern mit folgender Begründung: Bei
Honorarzahlungen der Mandantschaft handelt es sich nicht um anvertraute, fremde Vermögenswerte im Sinne von § 43 a Abs. 5 Satz 1 BRAO. Vielmehr darf und soll der Rechtsanwalt über dieses Geld im eigenen Interesse verfügen, da es ihm der Auftraggeber zur Nutzung für eigene Zwecke übereignet hat.
Aus demselben Grund, so der AGH, stellt der Honorarvorschuss kein Fremdgeld dar. Der Anwalt sei zwar als Nebenpflicht aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag gehalten, abzurechnen und einen etwaigen Überschuss zu erstatten, hierdurch werde der zu erstattende Vorschuss aber weder Fremdgeld noch fremder Vermögenswert. Ich halte beides für richtig. Etwas anderes ergebe sich auch nicht aus § 23 BORA.
Und jetzt sind wir beim Problem: Nach dieser Vorschrift hat der Rechtsanwalt zwar spätestens mit Beendigung des Mandats gegenüber dem Mandanten über Honorarvorschüsse unverzüglich abzurechnen, die Abrechnung war vorliegend aber unverzüglich erfolgt. Lediglich die Rückzahlung des Honorarüberschusses war nicht unverzüglich.
Für den AGH stellte sich also die Frage, ob unter „Abrechnung“ im Sinne des § 23 BORA auch die Auskehrung eines eventuellen Überschusses zu verstehen ist. Der AGH verneint dies unter Hinweis auf das Bestimmtheitsgebot nach Art. 103 Abs. 2 GG. Das Gebot der gewissenhaften Berufsausübung (§ 43 BRAO), so der AGH weiter, könne nicht herangezogen werden, da sich der Satzungsgeber in § 23 BORA auf die Abrechnung beschränkt und keine Pflicht zur unverzüglichen Auskehrung eines Überschusses an den Mandanten normiert habe. Eine subsidiäre Heranziehung der Vorschrift komme also nicht in Betracht. Beides halte ich gleichfalls für richtig. Der Anschuldigungserzwingungsantrag wurde deshalb zurückgewiesen.
Ich habe dies zum Anlass genommen, den Ausschuss 2 der Satzungsversammlung, dem ich angehöre, zu bitten, einen Zusatz in § 23 BORA zu erarbeiten und der Satzungsversammlung zur Entscheidung vorzulegen, etwa in dem Sinne, dass der betroffene Rechtsanwalt einen verbleibenden Überschuss unverzüglich an den Berechtigten auszukehren hat. Der Ausschuss 2 hat jedoch das getan, was jeder gute Richter tut. Er hat zunächst seine Zuständigkeit geprüft und diese verneint. Hierfür sei, so meinte die Mehrheit, der Ausschuss 3 der Satzungsversammlung (Geld, Vermögensinteressen, Honorar) zuständig.
Nach entsprechender Verweisung an diesen Ausschuss berichtete Präsident Schons in der Sitzung des Gesamtplenums der Satzungsversammlung am 15.04.2013, der Ausschuss 3 sei zu dem vorläufigen Ergebnis gelangt, es bestehe keine Regelungslücke und deshalb auch kein Handlungsbedarf. Die Frage, ob eine Pflicht zur Auszahlung überzahlter Gebühren bestehe, sei eine zivilrechtliche Frage. Es sei falsch, eine Berufspflicht zur Auszahlung überzahlter Gebühren zu begründen, da in jedem Einzelfall zu prüfen sei, ob zivilrechtliche Vorschriften wie Zurückbehaltungsrechte oder eine Aufrechnungslage evtl. einer Auszahlung entgegenstünden. So weit der Bericht des Kollegen Schons über die Diskussion im Ausschuss 3.
Mich überzeugt dies nicht. Ich meine, hier besteht sehr wohl Handlungsbedarf.
Der Einwand einer möglichen Aufrechnungslage greift nicht. Wenn dem Rechtsanwalt eine aufrechnungsfähige Forderung zusteht, kann er diese in die Schlussabrechnung einstellen. Zum Zurückbehaltungsrecht habe ich bislang noch keinen Fall erlebt, dass ein solches nach Mandatsbeendigung besteht und die Auszahlung eines Überschusses hindern könnte. Es verbleibt deshalb dabei, dass der Rechtsgrund für das Behalten einer überschüssigen Vorschusszahlung mit Mandatsbeendigung/Abrechnung des Mandats nachträglich weggefallen ist und damit eine zivilrechtliche Auszahlungsverpflichtung besteht. Wir sollten uns hüten, dem rechtsuchenden Publikum zu erläutern, dass es sich hierbei weder um Fremdgeld noch um fremde Vermögenswerte handelt. Wenn schon wir, die (kluge) Kammer Hamm dies nicht auf Anhieb erkannt haben, wie soll dies der (arme) Mandant verstehen.
Denken wir stets daran: Der sorgfältige Umgang mit „fremdem Geld“ und „fremden Vermögenswerten“ ist eine Kardinalpflicht unseres Berufsstandes. Das Allensbach – Meinungsforschungsinstitut hat jüngst nach einer neuesten Umfrage einen schleichenden Ansehensverlust der Anwaltschaft festgestellt. Während wir vor wenigen Jahren noch an dritter bzw. vierter Stelle im öffentlichen Ansehen lagen, rangieren wir mittlerweile unter „ferner liefen“.
Deshalb muss nach meinem Verständnis der Rechtsanwalt, der zivilrechtlich aus einem Mandatsverhältnis zur Auszahlung von Geld verpflichtet ist, das ihm nicht zusteht, mit berufsrechtlichen Sanktionen rechnen, wenn er dieser Pflicht nicht unverzüglich nachkommt. Nur dies kann unserem Berufsstand zur Ehre gereichen, nicht aber fernnervige Differenzierungen zwischen „Fremdgeld“ und „fremden Vermögenswerten“ sowie zwischen Aufrechnungslage und Zurückbehaltungsrecht. Hier liegt nach meinem Verständnis ein klassischer Fall des berufsrechtlichen Überhangs vor, den man einer vernünftigen Regelung zuführen kann. Man muss es nur wollen.[2]
Stellung des Syndikusanwalts
Hier haben wir es mit einer ganz schwierigen Problematik zu tun.
Bekanntlich sind nicht nur in Deutschland, sondern auch in den meisten Staaten der EU Syndikusanwälte den „freien Rechtsanwälten“ nicht gleichgestellt. Eine allgemeine Tendenz hin zu einer Gleichstellung kann auch nicht festgestellt werden.[3] Deshalb stehen Syndikusanwälten weder ein Zeugnisverweigerungsrecht noch ein Beschlagnahmeprivileg zu.[4] Hierbei handelt es sich, so Kleine-Cosack[5], um „bisher noch weitgehend unangetastete Elementarrechte der freien Rechtsanwälte“. Und er fügt hinzu, ihre uneingeschränkte Übertragung auf unterschiedlichste Formen von Firmenanwälten „könnte sie langfristig gefährden“. Er meint dann zwar weiter, die von der Rechtsprechung vertretene Zwei-Berufe-Theorie[6] sei „an tatsächlicher Kurzsichtigkeit nicht zu überbieten“, und er ruft die Syndikusanwälte auf, „endlich den Gang aus der selbstverschuldeten berufspolitischen Unmündigkeit anzutreten“ und fordert deshalb eine Regelung zur Gleichstellung der Syndikusanwälte mit niedergelassenen Rechtsanwälten.[7] Gleichzeitig weist er aber darauf hin, eine schematische Gleichstellung beider Anwaltsformen verbiete sich „angesichts der von EuGH wie BGH zu Recht betonten Unterschiede. Die meisten Berufspflichten einschließlich des RVG sind bei Syndikusanwälten ohnehin unanwendbar“.[8]
Man sieht, wie komplex die Problematik des Syndikusanwaltes ist. Auch Kleine-Cosack hat kein Patentrezept.
Der BRAO-Ausschuss hatte den Auftrag, eine rechtliche Lösung zu erarbeiten für den Fall, dass sich die Hauptversammlung der Bundesrechtsanwaltskammer mehrheitlich dafür ausspricht, dem Syndikus in Abkehr von der Zwei-Berufe-Theorie eine weitergehende Rechtsstellung als bisher bis hin zur Gleichstellung mit dem niedergelassenen Rechtsanwalt einzuräumen. Hier geht es um den Eintritt der Syndici in das anwaltliche Versorgungswerk, die Anerkennung der im Unternehmen bearbeiteten Rechtsfälle als Fälle zum Erwerb der Fachanwaltschaft, die Wettbewerbsverzerrung im internationalen Rechtsverkehr wegen des fehlenden Zeugnisverweigerungsrechts sowie des Beschlagnahmeverbots und um die Vertretung des Dienstherrn in dessen Sachen vor Gerichten und Schiedsgerichten. In 8 Sitzungen hat der Ausschuss ein „Tätigkeitsmodell“ und ein „Zulassungsmodell“ entwickelt und sich letztlich auf das Zulassungsmodell verständigt, das in der Hauptversammlung der Bundesrechtsanwaltskammer in Freiburg am 18.10.2013 andiskutiert und an die Regionalkammern zur weiteren Diskussion überwiesen wurde.
Hier stellt sich nach meinem Verständnis ein berufsrechtliches, aber auch (und insbesondere) ein berufspolitisches Problem. Gleich zu letzterem: Wenn man dem Syndikus durch eine Gleichstellung mit dem niedergelassenen Rechtsanwalt Zeugnisverweigerungsrecht und Beschlagnahmeverbot zubilligt, dann wird man ihm schwerlich noch die Vertretung seines Arbeitsgebers/Dienstherrn vor Gericht untersagen können – so aber der geltende § 46 Abs. 1 BRAO. Dem wiederholt vorgebrachten Argument, Syndikusanwälte würden auch in Zukunft ihren Dienstherrn nicht vor Gericht vertreten, begegne ich mit großer Zurückhaltung. Wer einmal seine Singularzulassung beim Oberlandesgericht verloren hat, weiß um die Treueschwüre der Kollegenschaft. Im Übrigen ist dies allenfalls ein Generationenproblem.
Für mich stellt sich nach wie vor die Frage, ob es tatsächlich gerechtfertigt ist, bei generalisierender Betrachtung den Syndikusanwalt einem freien Anwalt gleichzustellen. Syndici haben keine Mandanten, sondern einen Dienstherrn. Dieser ist der einzige Mandant und zu ihm stehen sie in einem ständigen Dienstverhältnis und unterliegen seinen arbeitsvertraglichen Beschränkungen. Sie können das Mandat nicht ablehnen und auch nicht niederlegen. Sie tragen auch kein wirtschaftliches Risiko, unterliegen nicht dem anwaltlichen Vergütungsrecht und üben ihren Beruf mit erheblicher Fremdkapitalbeteiligung (in Form materieller und personeller Büroausstattung) aus. Und der Kapitalgeber wiederum ist der nicht anwaltliche Arbeitgeber und gleichzeitig der einzige Mandant.
Um es kurz zu machen: Der Syndikus kann sich weder seine Fälle noch seine Mandanten und auch nicht sein Dienstzimmer aussuchen. Freiheit und Unabhängigkeit eines Anwalts sind mehr als nur unabhängige Rechtsberatung. Deshalb teile ich auch nicht die Ansicht von Offermann-Burckart, die kürzlich im Anwaltsblatt in diesem Zusammenhang vom „Mysterium“ der Unabhängigkeit gesprochen hat.[9]
Dabei verkenne ich nicht, dass damit das Problem nicht ansatzweise gelöst ist. Ich will nur aufzeigen, dass es mir jedenfalls schwerfällt, unbesehen von der Zwei-Berufe-Theorie der Rechtsprechung Abschied zu nehmen und eine weitgehende Gleichstellung des Syndikusanwalts mit dem niedergelassenen Rechtsanwalt zu fordern. Deshalb meine ich auch, dass die Diskussion mit dem jetzt vorliegenden Vorschlag des BRAO-Ausschusses noch nicht zu Ende ist. Sie fängt erst einmal richtig an. Wir sollten nichts über’s Knie brechen. Insbesondere sollten wir nicht in der Satzungsversammlung vorauseilende Regelungen im Sinne einer Gleichstellung beschließen und uns in der BRAK-Hauptversammlung unter Zeitdruck setzen. Die Problematik ist es wert, dass man etwas länger darüber nachdenkt.
Sanktionierte Fortbildungspflicht
§ 43 a Abs. 6 BRAO lautet: „Der Rechtsanwalt ist verpflichtet, sich fortzubilden“.
Damit hat der Gesetzgeber klargestellt, dass die Fortbildung zu den Kardinalpflichten der Anwaltschaft gehört. Und dies zu Recht. Ohne Fortbildung gibt es keine Qualitätssicherung und ohne Fortbildung kann ein Mandat nicht verantwortlich bearbeitet werden. Kurz gesagt: Anwaltliche Fortbildung ist unabdingbar. Die Frage ist aber: Muss Fortbildung deshalb kontrolliert und unterlassene Fortbildung sanktioniert werden? Der Gesetzgeber von 1994 hat bewusst auf Kontrolle und Sanktion verzichtet.
Bevor man also nach einer Änderung ruft, ist eine Bestandsaufnahme notwendig und das heißt: In welchem Umfang kommt die Anwaltschaft ihrer Fortbildungspflicht nach? Nach einer Untersuchung von Hommerich/Kilian[10] haben im Jahre 2008 72 % der Nichtfachanwälte Fortbildungsveranstaltungen im Umfang von 11 bis zu 60 Stunden (und mehr) pro Jahr besucht. Die übrigen 28 % liegen bei bis zu 10 Stunden pro Jahr. Wenn dies repräsentativ ist, dann belegen mindestens 72 % der Anwaltschaft mehr Fortbildungsstunden als § 15 FAO von Fachanwälten verlangt. Rechnet man dann noch das Studium von Fachliteratur und das Verfassen fachspezifischer Beiträge hinzu sowie Prozess- und Beratungsmandate, die zwar zum „täglich Brot“ eines jeden Rechtsanwalts gehören, letztlich aber auch eine Art Fortbildung sind, dann gelangt man unschwer zu dem Ergebnis, dass es um die freiwillige Fortbildung in der Anwaltschaft doch nicht so schlecht bestellt ist, wie manche meinen.
Die Befürworter der sanktionierten Fortbildungspflicht sehen dies offenbar ähnlich und fordern deshalb eine „systemische Lösung“.[11] Kontrolle und Sanktion der Fortbildung seien, so heißt es, ein für den Erhalt des Berufsstandes notwendiges Instrumentarium. Dem dürfte jedoch das vorstehend dargelegte Fortbildungsverhalten der Anwaltschaft fast schon gerecht werden.
Stichprobenartige Kontrollen, wie gleichfalls vorgeschlagen, helfen nicht weiter. Wie viele Stichproben bei mehr als 160.000 Kammermitgliedern sind erforderlich? Ist überhaupt das Zufallsprinzip zur flächendeckenden Qualitätssicherung geeignet? Stehen Eingriffszweck und Eingriffsintensität noch in einem angemessenen Verhältnis zueinander? Vor allem aber: An welchen Tatbestand soll die Sanktion anknüpfen?
Aufschlussreich sind insoweit die Beiträge von Eichele/Odenkirchen[12] und Dahns/Eichele.[13] Hiernach gibt es beispielsweise in den Niederlanden bei Fachartikeln für 500 Worte einen Punkt, in Frankreich für eine Fortbildungsstunde 10.000 Zeichen – wer soll dies alles zählen? – während bei der Lehrtätigkeit „dieSpannbreite von einem Punkt für 30 Minuten Lehrtätigkeit in den Niederlanden bis zur Anrechnung von 4 Stunden Fortbildung für eine Stunde Lehrtätigkeit in Frankreich“[14] reicht. Wollten wir für mehr als 160.000 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Vergleichbares übernehmen, wären wir nahe beim mittelalterlichen Hexenhammer. Nicht von ungefähr hat Franz[15] die Frage aufgeworfen, weshalb die Fachlektüre bei einem Glas Rotwein auf der Terrasse nicht auch Fortbildung sein kann.
Selbst Ewer[16] – Befürworter von Kontrolle und Sanktion – weist zutreffend darauf hin, die Themenbreite geeigneter Fortbildung könne kaum abschließend festgelegt werden. Er appelliert an die „eigenverantwortliche Gestaltung des
Einzelnen“. Aber was sollen wir dann noch sanktionieren? Bezeichnenderweise schließt auch Offermann-Burckart ihre Darlegungen zur sanktionierten Fortbildung mit der Erkenntnis, an die Fortbildungsnachweise seien „keine zu hohen Anforderungen“ zu stellen, notfallswürde „auch die anwaltliche Versicherung ausreichen, bestimmte Fachliteratur gelesen zu haben“.[17]
Die gute Absicht mündet also in die Erkenntnis, dass ein ins Detail gehender Fortbildungskatalog, verbunden mit Kontrolle und Sanktion, eigentlich nicht machbar ist und deshalb letztlich auch nicht zur Qualitätssicherung beiträgt.
Und ein letztes: Sind eigentlich Rüge und anwaltsgerichtliche Maßnahmen wirklich angezeigt, wenn ein Rechtsanwalt nicht die vom Gesetzgeber und der Satzungsversammlung für ihn als „richtig“ erachtete Fortbildung wahrnimmt? Es gibt nicht wenige Kollegen, die der – wie ich meine, zutreffenden – Ansicht sind, dass sich ein Rechtsanwalt, der sich an 40 Wochenenden im Jahr jeweils 1,5 Stunden mit der für ihn fachspezifischen Lektüre befasst, deutlich umfangreicher fortbildet, als derjenige, der lediglich einmal pro Jahr eine 10-stündige Fortbildungsveranstaltung besucht. Den „Bodensatz“ von etwa 5 %, der sich nach der Untersuchung von Hommerich/Kilian zurzeit überhaupt nicht fortbildet, wird man auch nicht mit einer kontrollierten und sanktionierten Fortbildungspflicht einfangen können.
Zu Recht hat Kilger bereits 1995 darauf hingewiesen, der Gesetzgeber habe uns in § 43 a Abs. 6 BRAO „durch die wörtliche Aufnahme der Fortbildungspflicht nicht aufgefordert, mit einem großen Kraftakt ein Kontrollnetz über die Anwaltschaft zu werfen“.[18] Hieran hat sich, so meine ich, bis heute nichts geändert.
* Vortrag anlässlich der Tagung der Anwaltsgerichtsbarkeit NRW am 25.09.2013 in Hamm
[1] AGH NRW, NJW-RR 2013, S. 624 ff.
[2] Der Ausschuss 3 der Satzungsversammlung wird in der Dezember-Sitzung des Gesamtplenums einen Ergänzungsvorschlag zu § 23 BORA vorlegen.
[3] so EuGH NJW 2010, S. 3557 ff., 3561 Nr. 73 = BRAK-Mitt. 2010, S. 259 ff., 263.
[4] Anders zur Rechtslage in Deutschland (aber ohne entsprechende Rechtsprechungshinweise): Huff, in:
Gaier/Wolf/Göcken, Anwaltliches Berufsrecht (2010), § 46, Rn. 15; Merkt, Syndikusanwalt und deutsches Anwaltsprivileg im US-Zivilprozess (Besprechung bei Kilian, AnwBl. 2013, S. 804).
[5] Kleine-Cosack, Syndikusanwälte ante portas? AnwBl. 2011, S. 467 ff., 468.
[6] Hierzu EuGH, NJW 2010, S. 3557 ff.; BVerfG, BRAK-Mitt. 1993, S. 50 ff.; BGH, BRAK-Mitt. 1999, S. 149 ff.
[7] a.a.O., S. 472.
[8] a.a.O., S. 472.
[9] Offermann-Burckart, Die Systemrelevanz von Syndikusanwälten, AnwBl. 2012, 778 ff. (780).
[10] Hommerich/Kilian, Berufsrechtsbarometer 2009, S. 115 ff., 117.
[11] Ewer, NJW-Editorial, H. 29/2013.
[12] Eichele/Odenkirchen, Qualitätssicherung durch überprüfbare Pflichtfortbildung, BRAK-Mitt. 2005, 103 ff.
[13] Dahns/Eichele, Die Allgemeine Fortbildungspflicht deutscher und europäischer Rechtsanwälte unter
Berücksichtigung des Rechts anderer freier Berufe, BRAK-Mitt. 2002, S. 259 ff.
[14] Eichele/Odenkirchen, a.a.O., S. 104.
[15] Franz, Qualitätssicherung aus Sicht des Bundesministeriums der Justiz, BRAK-Mitt. 2005, 106 ff.,
109; hier auch zu weiteren verfassungsrechtlichen Problemen der sanktionierten Pflichtfortbildung.
[16] Ewer, NJW-Editorial, H. 29/2013.
[17] Offermann-Burckart, Zwischen Qualitätsssicherung, Marketing und Berufsfreiheit, Anw.Bl. 2008, S. 763
ff., 767.
[18] Kilger, Fortbildung des Rechtsanwalts, AnwBl. 1995, 435 ff., 439.