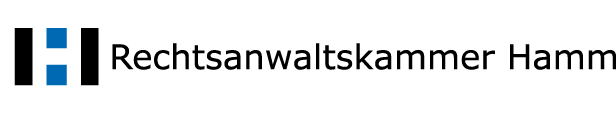BRAO § 49 b Abs. 4; BGB § 398, § 675
Zur Abtretung anwaltlicher Honorarforderungen
BGH, Urt. v. 11.11.2004 – IX ZR 240/03
Fundstelle: BRAK-Mitt. 2005, 34
Tritt ein RA Honorarforderungen ohne Zustimmung des Auftraggebers an einen anderen RA ab, der ihn zuvor außergerichtliche und in Kostenfestsetzungsverfahren (§ 19 BRAGO) vertreten und die Angelegenheit umfassend kennen gelernt hat, so ist die Zession nicht gemäß §§ 134 BGB, 203 Abs. 1 Nr. 3 StGB unwirksam.
Anmerkung:
Gemäß § 49 b Abs. 4 S. 1 BRAO ist der Rechtsanwalt, der eine Gebührenforderung erwirbt, in gleicher Weise zur Verschwiegenheit verpflichtet, wie der beauftragte Rechtsanwalt.
Streitig ist, ob es diese gesetzliche Regelung ermöglicht, ohne Zustimmung des Mandanten die anwaltliche Vergütungsforderung an einen anwaltlichen Zessionar abzutreten. Die wohl herrschende Meinung bejaht dies (LG Regensburg, NJW 2004, 3496; LG Baden-Baden, NJW-RR 1998, 202, 203; Dittmann in Henssler/Prütting, § 49 b Rn. 37; Feuerich/Weyland, § 49 b. Rn. 47 f; Jessnitzer/Blumenberg, § 49 b Rn. 7). Zum Teil wird allerdings vertreten, § 49 b Abs. 4 S. 1 BRAO gebe lediglich die Verschwiegenheitspflicht des Zedenten an den Zessionar weiter, so dass eine Abtretung ohne Zustimmung des Mandanten die anwaltliche Verschwiegenheitspflicht gemäß §§ 203 Abs. 1 Nr. 3 StGB, 43 a Abs. 2 BRAO verletzt (OLG Düsseldorf, NJW-RR 1999, 1583, 1584; LG Karlsruhe, MDR 2001, 1383, 1384; Berger, NJW 1995, 1406, 1407; Prächtel, NJW 1997, 1813, 1816).
Der BGH konnte im zu entscheidenden Fall die Streitfrage offen lassen, da der Forderungsempfänger bereits vor der Abtretung rechtmäßig umfassend Kenntnis von der Angelegenheit erhalten hatte.
Damit lässt eine höchstrichterliche Entscheidung, unter welchen Voraussetzungen ein Rechtsanwalt Vergütungsforderungen abtreten darf, leider weiter auf sich warten. Ein entsprechender Forderungsverkauf ist als Finanzierungsinstrument oder aus Gründen der Rationalisierung (Entlastung von Arbeiten wie Rechnungsstellung, Zahlungsüberwachung, Forderungseintreibung und Mahnwesen) durchaus interessant.
So wird bereits über die Zulässigkeit einer Anwaltlichen Verrechnungsstelle diskutiert, die, ähnlich wie die bei Ärzten bekannte Verrechnungsstellen, anwaltliche Honorarforderungen ankauft und die Zahlungsabwicklung übernimmt.
Sofern ein Einverständnis der Mandantschaft vorliege, sei die Inanspruchnahme der Dienstleistungen einer solchen Verrechnungsstelle, so Teile des Schrifttums, auch für Anwälte möglich (Römermann/Hartung, RVG, § 1 Rn. 115; Frenzel, AnwBl. 2005, 121 ff).
Dem könnte allerdings § 49 b Abs. 4 Satz 2 BRAO entgegenstehen, wonach der Verkauf einer anwaltlichen Gebührenforderungen an einen nicht zur Rechtsanwaltschaft zugelassenen Dritten nicht nur die mandantschaftlichen Einwilligung voraussetzt, sondern darüber hinaus nur zulässig ist, wenn die Forderung rechtskräftig festgestellt und ein erster Vollstreckungsversuch fruchtlos ausgefallen ist.
Gegen ein allein am Wortlaut orientiertes Verständnis der Norm wird nun teilweise mit Hinweis auf die Gesetzesbegründung vertreten, § 49 b Abs. 4 S. 2 BRAO sei berichtigend auszulegen. Danach ermögliche die Norm zwei Varianten: Entweder die Abtretung einer Gebührenforderung mit Einwilligung des Mandanten oder (alternativ) die Abtretung nach Titulierung und erfolgloser Vollstreckung (Römermann/Hartung, a. a. O.; Frenzel, a. a. O.).
Ob § 49 b Abs. 4 S. 2 BRAO allerdings derart verstanden werden kann, erscheint zweifelhaft. Der subjektive Wille des Gesetzgebers, den Anwälten die Durchsetzung wirtschaftlicher Interessen zu erleichtern, hat im Gesetz (nur) insoweit Ausdruck gefunden, als die Abtretung einer Honorarforderung an einen Dritten das kumulative Vorliegen der in § 49 b Abs. 4 Satz 2 BRAO normierten Voraussetzungen bedingt. Der eindeutige Wortsinn der Norm ist bindend. Allein die Einwilligung der Mandanten in einen Forderungsverkauf an eine Anwaltliche Verrechnungsstelle genügt also nicht.
RA Stefan Peitscher, Geschäftsführer der RAK Hamm